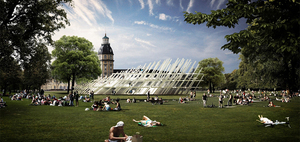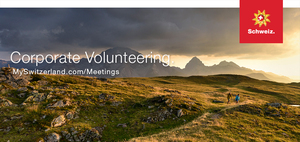Pläne B
„Wir brauchen ein Bewusstsein, dass auch alles anders laufen könnte"

Die Online-Plattform für Zukunftsideen changeX behandelt Themen des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft. In Kooperation mit dem MICE Club veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen spannende Beiträge unseres Content-Partners, wenn wir diese für unsere Leserschaft interessant finden.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten so gelebt, als ginge immer alles so weiter. Die Stabilität der Gesellschaft wurde nicht hinterfragt, auch nicht das Funktionieren der Technik, von der sie abhängt. Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass immer alles funktioniert, sagt ein Experte für Technikfolgenabschätzung. Diese unausgesprochenen Gewissheiten sind heute erschüttert. Seine Schlussfolgerung: Wir müssen uns unsere krasse Abhängigkeit von Technologien und Wirtschaftsprozessen ins Gedächtnis rufen. Und brauchen Alternativen.
Wir brauchen Pläne B. Und wir brauchen Technologien, die nicht alles auf eine Karte setzen. Das ist das Fazit von Armin Grunwald. Zu lange hat unsere Gesellschaft auf ein Weiter-so gesetzt.
Armin Grunwald ist Physiker und Philosoph. Er leitet das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Als Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) in Berlin ist er seit vielen Jahren in der Politikberatung aktiv. In seinem jüngsten Buch „Der unterlegene Mensch" beschäftigt er sich mit den Zukunftsaussichten unserer Zivilisation angesichts sich rapide entwickelnder technologischer Möglichkeiten.
Ein schwarzer Schwan, also ein nicht oder nur schwer vorhersehbares Ereignis, ist die Corona-Pandemie nicht. Seuchen begleiten die Menschheitsgeschichte - von der Pest bis zur Cholera. Haben sich unsere hoch entwickelten Gesellschaften in falscher Sicherheit gewiegt?
Leider wohl ja. Pest und Cholera sind ja lange her, jedenfalls in Europa. Mit Hygiene und moderner Medizin wurden sie erfolgreich zurückgedrängt. Der Siegeszug von Wissenschaft, Technik und Medizin über so viele Plagen der Menschheit hat uns verleitet, das Auftreten einer Pandemie nicht mehr wirklich im Bereich des Möglichen zu sehen. Zwar gab es Warnungen, so vor allem SARS vor knapp 20 Jahren, auch regelmäßig todbringende Epidemien wie Ebola in Afrika. Vor allem SARS - übrigens auch in China entstanden - hat damals die Menschen global verängstigt. Aber die Folgen waren sehr überschaubar im Vergleich zu heute, und nach einem halben Jahr war der Spuk wieder vorbei. Und ebenso schnell ist er aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden - ohne das Bewusstsein unserer Verletzlichkeit zu hinterlassen. Vielleicht hat die SARS-Epidemie sogar zum falschen Sicherheitsgefühl beigetragen, gerade weil sie vergleichsweise harmlos abgelaufen ist und rasch wieder vorüber war.
Handelt es sich um einen neuen Typus von Krise, zum Beispiel wegen der beschleunigten Ausbreitung des Virus in einer global vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft?
Auch frühere Epidemien haben sich durch Handelswege verbreitet, so zum Beispiel die Pest auf den Routen der Hanse um die Ostsee herum. Für Viren sind mobile Menschen ideal. Sie nutzen die Menschen gleichsam als Taxis, um sich überallhin bringen zu lassen. Interkontinentale Flüge gab es früher nicht, heute aber sind sie die ideale Gelegenheit für Viren, in ganz kurzer Zeit sehr weit zu kommen. Und da die Globalisierung seit dem Ende des Kommunismus eine früher ungeahnte Dynamik angenommen hat, ob nun in Geschäftsbeziehungen oder im Tourismus, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Viren wie des Covid-19-Erregers stark gestiegen. Also: kein prinzipiell neuer Typus von Krise, aber eine ganz gewaltige Steigerung der möglichen Gefährdung.
Wenn man die Coronakrise mit anderen Krisen in modernen Gesellschaften vergleicht: Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede sehen Sie?
Der erste Punkt ist, mit welchen Krisen man Corona vergleichen sollte oder könnte. Ich versuche es mal mit dem 11. September 2001. Der Terroranschlag auf das World Trade Center hat die Welt verändert, eine Welle von Sicherheitsmaßnahmen in Gang gesetzt, teils Grundrechte eingeschränkt und das Lebensgefühl vieler Menschen beeinträchtigt. Dennoch: Der weltweite Terrorismus hat bei Weitem nicht die Auswirkungen auf das Leben der Menschen wie Corona. Corona meint: Kontaktverbote und teils Ausgangssperre, Aussetzung von Versammlungs- und Religionsfreiheit sowie des Rechts auf Freizügigkeit - das rührt an den Kernbereich der modernen Demokratie, ist fast eine Notstandssituation. Auch andere Krisen verändern Gesellschaften dauerhaft. Aber die Allgegenwart von Corona, die Totalität über Wochen und Monate in den Medien, die Abschaffung von Öffentlichkeit, das Herunterfahren ganzer gesellschaftlicher Bereiche, das ist einmalig.
Welche dauerhaften, bleibenden Veränderungen könnten daraus erwachsen?
Es gibt zurzeit viele Auguren, die versuchen, etwas Positives für die Zukunft auszumalen. Psychologen sehen eine erneute Wertschätzung von Gemeinschaft kommen, Klimaschützer verantwortliches Handeln ohne Konsumrausch, Theologen neue Sinnsuche. Das ist kein Zufall. Viele Menschen brauchen jetzt eine Perspektive, denn außer dem Virus scheint es nichts anderes mehr auf der Welt zu geben, und das ist für Menschen auf längere Zeit nicht gut aushaltbar. Deshalb wird derzeit viel Positives über die Zeit danach erzählt. Diese Geschichten sind wichtig und notwendig - in einem therapeutischen Sinne. Damit Menschen sehen: Es kommt eine Zeit danach, auch mit durchaus guten Aussichten. Das heißt aber nicht, dass diese dann wirklich eintreffen. Ob sie eintreffen, wird man abwarten müssen. Tendenziell bin ich skeptisch.
Dennoch gibt es zahlreiche Berichte über Initiativen, die aus der Gesellschaft heraus entstehen. Unternehmen stellen ihre Produktion um und produzieren Schutzmasken, Desinfektionsmittel oder Beatmungsgeräte, App-Anbieter bieten ihre Dienstleistungen kostenlos an, ehrenamtliche Organisationen organisieren Hilfe für Risikogruppen, überall im Land werden Gesichtsmasken genäht. Mobilisiert die Krise die kreativen Ressourcen unserer Gesellschaft?
Zum Teil ja. Es herrscht jedoch vielfach noch eine Art Schockstarre. Kreativität gibt es vor allem im kleinräumigen Bereich, in christlichen Gemeinden und anderen Gemeinschaften blüht die Nachbarschaftshilfe, gerade die Hilfe für Risikogruppen. Es ist eine gute Erfahrung, dass viele Menschen nicht nur auf das schauen, was jetzt alles verboten ist, und darüber klagen, sondern danach fragen, wo Hilfe benötigt wird und was sich tun lässt. Ich hoffe nicht nur, dass diese Haltung auch über möglicherweise viele Wochen oder sogar Monate anhält, sondern dass sie um sich greift.
Leider gibt es aber auch gegenteilige Erfahrungen. Bereits in der ersten ernsthaften Krisenwoche kam der Ruf nach Wirtschaftshilfe vom Staat auf und wurde immer mächtiger. Der Bundestag hat bereits das größte Hilfspaket der Geschichte beschlossen. Auch wenn ich die Notwendigkeit dieser Maßnahmen nicht bestreiten will, dazu verstehe ich zu wenig davon, aber kreativ war das nicht. Es war der über Jahrzehnte eingeübte und immer funktionierende Reflex: Wenn die Wirtschaft Probleme bekommt, soll der Staat helfen. Dass unser Wirtschaftssystem scheinbar so marode ist, dass es nicht einige Wochen Krise aushält, das hat mich schockiert.
Zu den Wirkungen der Coronakrise gehört auch, dass sie die Klimathematik schlagartig aus der öffentlichen Wahrnehmung gekickt hat. Mit welchen Folgen?
Die Coronakrise verringert die Umweltverschmutzung. Die Wirtschaft runterzufahren, nützt dem Klima. Aber das ist keine Lösung! Ich befürchte, dass das gerade wieder erwachte Problembewusstsein zum Klimawandel erst mal weg ist. Auch einflussreiche Zeitungen schreiben schon, dass angesichts des Virus das Klima vielleicht doch nur ein Scheinproblem sei. Das ist gefährlich, denn das Klimaproblem bleibt und wird sich verschärfen.
Dennoch gilt es als verpönt, Klimakrise und Coronakrise in einen Zusammenhang zu bringen. Zu Recht?
Vergleichen kann man alles Mögliche, man muss nur sagen, zu welchem Zweck und in welcher Hinsicht. Vergleichen heißt ja gerade nicht gleichsetzen, sondern Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Mit einem sorgfältigen Vergleich habe ich kein Problem. Gleichsetzen oder gar gegeneinander ausspielen geht aber gar nicht.
Sehen Sie in diesem Sinne Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Krisen?
Es gibt wohl mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten sind der globale Charakter der Krise, die Notwendigkeit abgestimmten Handelns, die Herausforderungen an die Wissenschaften, allerdings an andere Disziplinen. Unterschiede zeigen sich vor allem im Charakter der Krisen. Corona ist innerhalb von Monaten zu einer globalen Bedrohungslage geworden, während der Klimawandel seit etwa 40 Jahren (!) Thema ist. Bei Corona geht es um direkte Gefahrenabwehr, beim Klima um langfristige Vorsorgemaßnahmen. Das Klimaproblem erreicht zwar schon die Lebenswelt der Menschen, etwa durch Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen, aber der reale Eingriff in das persönliche Leben beschränkt sich auf solche Ereignisse. Und: Das Virus bedroht uns alle, und zwar jetzt, während die Bedrohung durch den Klimawandel für viele noch weit weg ist.
Also: Das ist ein ganz anderer Typ von Problem - was übrigens auch die unterschiedliche Reaktion von Politik und Gesellschaft betrifft. Das Klimaproblem wird endlos diskutiert, getan wird eher wenig - das Virus legt ganze Gesellschaften und die Wirtschaft lahm, demokratische Rechte werden außer Kraft gesetzt, soziale Isolierung wird zum politischen Ziel erklärt, und zwar alles praktisch sofort. Auf keinen Fall aber darf man die Frage stellen, was denn schlimmer ist, die Klima- oder die Coronakrise. Sie kann nur zur Verharmlosung einer der beiden Krisen führen.
Auch wenn es noch früh ist - was lernen wir aus der Coronakrise?
Wichtig wäre mir zumindest eine Lektion. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so gelebt, als ginge im Großen und Ganzen immer alles so weiter. Es gab Irritationen wie den Jugoslawienkrieg, den 11. September, die Flüchtlingskrise, aber die Stabilität der Gesellschaft wurde nicht hinterfragt. Die Viruswarnungen nach SARS wollte niemand wirklich hören. Und auch als Corona in China ausgebrochen ist, gab es eine unausgesprochene Gewissheit: Uns trifft das nicht, hier ist alles stabil. Und eine solche unausgesprochene Gewissheit findet sich auch im völligen Vertrauen in Technik. Wir müssen uns unbedingt unsere krasse Abhängigkeit von Technologien und Wirtschaftsprozessen ins Gedächtnis rufen. Ohne Strom und Internet, ohne globale Lieferketten und Mobilität bricht alles zusammen. Wir haben uns zu sehr daran gewöhnt, dass immer alles funktioniert. Ist ja auch bequem. Aber diese Sicherheiten sind jetzt erschüttert, und das ist eine Chance. Wir brauchen ein Bewusstsein, dass auch alles anders laufen könnte. Wir brauchen Pläne B für den Fall der Fälle! Und wir brauchen Technologien, die nicht alles auf eine Karte setzen. Das kann für Dezentralisierung sprechen, zum Beispiel in der Energiewende oder im Digitalbereich.
Technologien, die nicht alles auf eine Karte setzen - würden Sie bitte diesen Gedanken ein wenig ausführen?
Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten immer abhängiger von Technik, und zwar von ganz bestimmten Technologien gemacht. Wenn wir aber hundertprozentig abhängig von einer Technik sind, und die dann mal nicht funktioniert, dann bricht alles zusammen. Das ist heute das Internet. Wenn das mal nicht ginge, bräche die Weltwirtschaft zusammen, und keiner könnte sie mehr retten. Ein solcher Zusammenbruch würde nicht nur unsere Kommunikation betreffen, sondern auch die globalen Logistikketten, die unsere Supermärkte mit Lebensmitteln versorgen, unsere mittlerweile stark digitalisierte Wasserversorgung und auch die Stromversorgung. Nur ein Beispiel: Wenn wir das Bargeld abschaffen, was de facto in Skandinavien bereits passiert ist, setzen wir alles auf die eine Karte, nämlich die Kredit- oder Sonst-wie-Bezahlkarte. Wunderbar bequem, solange alles funktioniert! Aber wenn nicht, dann könnte man nichts mehr kaufen, nichts. Dann bliebe, so befürchte ich, nur noch das Plündern von Lebensmittelgeschäften, um etwas ganz Böses zu sagen.
Wie müssen technische und ökonomische Systeme ausgelegt sein, damit sie robust sind und in Krisen nicht gleich in die Knie gehen? Zwei Punkte haben Sie angesprochen: Diversität und Dezentralität. Also unterschiedliche technologische Lösungen, die zudem räumlich verteilt sind?
Ja, eine wenigstens gewisse Diversität von mindestens zwei Optionen. Das Beispiel Bezahlen passt hier gut: Jetzt haben wir noch zwei Optionen, Karte und Cash. Wenn Barzahlung abgeschafft wird, verbleibt nur noch eine Option - und damit die totale Abhängigkeit vom Funktionieren des Internets. In der Energieversorgung würde das bedeuten, das System so auszulegen, dass bei einem Komplett-Blackout wenigstens einzelne Teile wieder hochgefahren werden können, wenn das für das Gesamtsystem nicht klappt. In einer Studie für den Bundestag haben wir mal sogenannte „Insellösungen" empfohlen. Generell ist geraten, bei allen lebenswichtigen Infrastrukturen abzuschätzen, was im Falle eines Totalausfalls, ob nun durch technisches Versagen, Hackerangriff oder noch andere Ursachen, getan werden kann, um die Folgen bis zum Wiederhochfahren möglichst klein und verantwortbar zu halten.
Ist das auch ein Argument für Redundanz, für Reservekapazitäten, die in Systemen zur Verfügung stehen?
Ja, ist es. Reservekapazitäten oder die eben genannten Insellösungen sind typische Vorsorgemaßnahmen für den Fall der Fälle, den sich niemand wünscht, der sicher auch eher unwahrscheinlich ist, aber der nicht auszuschließen ist. Wenn ich unsere Versorgungssituation mit Mundschutz und Beatmungsgeräten ansehe, war das arg wenig Vorsorge. Freilich kostet Vorsorge Geld, Redundanzen wollen installiert und gepflegt werden. Vorsorge ist eine öffentliche Aufgabe. Hier gibt es Nachholbedarf.
Solche Reservekapazitäten werden gerne als „Überkapazitäten" wegrationalisiert. In Krisen zeigt sich, dass das ein fataler Fehler ist?
Ja, genau so ist es. Und genau deswegen ist die liberale Marktwirtschaft schlecht in Vorsorge. Das System ist ja darauf ausgelegt, vorhandenes Kapital zu investieren, um weiteres Wachstum zu erzeugen, nicht um es in Vorsorgemaßnahmen quasi zu vergraben - für Eventualitäten, die vielleicht nie eintreten. Solange Wettbewerb und Kostendruck die einzigen Treiber sind, wird niemand in die Vorsorge gehen - das wäre ökonomisch unsinnig! Stattdessen schleicht sich die Meinung ein, dass alles schon gut gehen wird.
Übrigens ist gerade im Moment hautnah zu beobachten, welche Folgen diese Haltung haben kann. In Deutschland, aber bei Weitem noch mehr in Italien und Spanien wurde das Gesundheitssystem auf Biegen und Brechen durchrationalisiert, in den letztgenannten Ländern noch mal verstärkt im Zuge der Eurokrise vor circa zehn Jahren. Die Folgen heute: ganz einfach tote Menschen.
Sie haben von dem Bewusstsein gesprochen, dass alles auch anders laufen könnte. Wird zu eingleisig gedacht?
Ja, vermutlich ist das allzu menschlich. Läuft alles eine Weile gut, denken wir, dass das immer so bleibt, und verlassen uns dann auch darauf. Ich darf mal von mir selbst sprechen. Ich bin ein typisches Nachkriegskind, aufgewachsen in einer Welt, die immer sicherer, immer demokratischer, immer wohlhabender, immer sozialer, immer friedlicher wurde - ja, würde das nicht immer so weitergehen? Aber dann gab es auf einmal in Europa den Jugoslawienkrieg, wo sich plötzlich frühere Nachbarn gegenseitig umgebracht haben. Der 11. September und das Erscheinen des internationalen Terrorismus waren für viele eine Irritation mit Folgen bis heute. Heute, nach dem Berliner Anschlag, auf Weihnachtsmärkte zu gehen, kann mit einem mulmigen Gefühl verbunden sein. Sich in falscher Sicherheit wiegen ist schnell durch die harte Realität widerlegt.
Wie ließe sich dieses Bewusstsein, dass alles auch anders laufen könnte, entwickeln?
Eigentlich sollte man meinen, dass unsere Erfahrungen, dass es immer wieder mal ganz anders kommt, als wir es uns gedacht hatten, uns doch davon kurieren sollten. Das scheint aber nicht so zu sein. Aus der Geschichte zu lernen ist nur, dass die Menschen nicht aus der Geschichte lernen, sagen manchmal die Historiker etwas resigniert. Aber es hilft ja nichts. Den Anspruch zu lernen können und dürfen wir nicht aufgeben. In meinem beruflichen Umfeld, und soweit ich auch öffentliche Kreise erreiche, versuche ich, das zu vermitteln. Darüber hinaus habe ich kein Patentrezept.
Dieses Interview veröffentlichen wir in enger Kooperation mit der Online-Plattform changeX.
changeX ist die Online-Plattform für Zukunftsideen, neue Wirtschaft und Innovation. changeX behandelt Themen, die morgen wichtig werden. In Essays, Interviews, Buchrezensionen und Reports suchen wir nach Ideen mit Zukunft. Im Mittelpunkt: Innovation, Führung, Management, Wirtschaft, Bildung, Denken, Zukunft und andere Themen des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft. Motto: „In die Zukunft denken“. Ziel: Angesichts der Turbulenzen der Zeit den Überblick zu wahren.
changeX erscheint im Abonnement online unter http://www.changex.de und ist in den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook und XING vertreten. Abonnenten können alle Beiträge auf dem Portal lesen und im Archiv mit mehr als 4.000 Artikeln recherchieren. changeX bietet Abo-Angebote für unterschiedliche Nutzerinteressen vom Lesen bis hin zum Weitergeben von Beiträgen unter Creative-Commons-Lizenz. http://www.changex.de/Page/AboOverview
Das könnte Dich auch interessieren:
Bildquelle: © Foto: Sandra Göttisheim / KIT